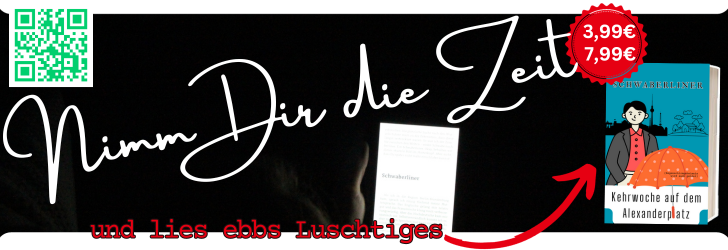Der Fluch der schwäbischen Herzöge – Teil IV – Das Ende ist nah
Das Herzogtum Schwaben existierte nun bereits seit einigen Generationen und brachte den Herzogen meist nur Leid. Zwar hat sich der König das Herzogtum einverleibt, doch die Mittel zur Macht bleiben brachial. Denn ein Herzogstitel war auch immer ein Sprungbrett für die adelige Karriere. Nun gelangten die Staufer und abschließend die Habsburger ans Herzogtum Schwaben. Aber auch sie waren Gefangene des Fluchs, der damit einherging.
Der letzte Teil des Fluchs der schwäbischen Herzöge.
Das Herzogtum Schwaben war von Anfang an von Missgunst und Neid sowie Mord und Intrigen begleitet. Es war der Schauplatz rebellischer Söhne gegen die väterliche Krone, es gab schreckliche Überfälle und es war ein ewiger Zankapfel. Um diese Macht zu erlangen, über der nur noch der König stand, wurden schreckliche Dinge getan. Schwaben erholte sich zwar, aber der Fluch des Machtgerangels forderte weitere Opfer. Heute ranken sich Legenden um ihr Unglück und ihre Machtversessenheit.
Wo sind wir? Die letzten zwei Herzöge waren Brüder. Der erste nannte sich Ernst II und wurde vom König und Stiefvater besiegt, der ihn als „tollwütigen Hund beschrieb“, und dieser Ernst II trieb es selbst für das ungezügelte Mittelalter recht doll. Sein Nachfolger Herman IV kam im Jahr 1030 mit gerade mal 15 Jahren auf den Thron und starb fünf Jahre später.

Der König Heinrich III übernahm das Amt des Herzogs von Schwaben 1038, aber auch als König und später als Kaiser. Doch das Herzogtum war bereits sehr schwachbrüstig und die Grafen gierten nach mehr. Das richtete sich zwangsläufig gegen den König. Die Grafen von Zähringen und aus dem Haus der Welfen erweiterten ihre Befugnisse ungefragt und sie intrigierten gegen den König, der das Herzogtum als Lehen vergab. Und bald tauchte Württemberg auf. Das elfte Jahrhundert war eine Zeit des Wandels, denn die Bevölkerung wuchs beträchtlich. Es werden neue Stellen geschaffen, die Ministeriale. Dagegen wehrte sich ein Teil des Hochadels. Und über allem schwelte die Frage, wie sehr muss die Kirche die Bibel befolgen und wer darf kirchliche Stellen besetzen? Der Papst oder der Kaiser? Es war der sogenannte Investiturstreit.
Der Anfang des Endes des Herzogtums Schwaben
Der tiefe Fall des Herzogs Ernst II von Schwaben erschütterte das Herzogtum gewaltig. Nach dem frühen Tod des Herzogs Hermann IV 1035 vereinte Heinrich III 1038 den Herzog von Bayern und den Herzog von Schwaben in seiner Person. Ein Jahr später wurde er zum Erben des Königs und noch später zum Kaiser gekrönt.
Im Jahr 1045 übergab er das Amt des Herzogs von Schwaben an den rheinischen Pfalzgrafen Otto. Aber bevor er in Schwaben überhaupt Fuß fassen konnte, starb Otto 1047 in Köln. Ihm folgte Otto von Schweinfurt, der nicht mal eine Urkunde in Schwaben signierte.
König Heinrich III versuchte sein Land zusammenzuhalten, doch es braute sich abermals eine Verschwörung gegen den König zusammen. Und Schwaben stand wieder in dessen Mittelpunkt. Der Herzog von Kärnten, Welf III, gesellte sich zur Opposition. Auch Kirchenvertreter waren in die Rebellion verwickelt. Aber mit dem Tod des Welfen 1055 erstickte der Aufstand.
Daran kann man die bereits erwachsene Macht der Grafen in Schwaben ablesen. Nicht nur die Welfen wehrten sich gegen einen Herzog, der nicht aus Schwaben stammte, auch die Staufer, die Zähringer und Habsburger wollten mehr Macht und Einfluss. Die Staufer und Welfen kämpften bald um die Herrscherwürde, wobei die Staufer eine Kaiserdynastie und die Habsburger das Erzherzogtum begründeten, die als Österreicher eine eigene Kaiserdynastie stellten. Sehr viel später wurde der schwäbische Adel der Zollern zu den Hohenzollern und schließlich zu den Königen von Preußen, deren Kaiser uns den Ersten Weltkrieg beschert hat.
Rudolf von Rheinfelden – Entführer, Aufrührer und Herzog von Schwaben? Der Mann mit der abgeschlagenen Schwurhand
Da Heinrich III 1056 verstarb, erhob die Kaiserin, Agnes, Rudolf von Rheinfelden im Jahr 1057 zum Herzog von Schwaben. Allerdings hatte der König zu Lebzeiten dem Zähringer Grafen Berthold die Nachfolge zugesichert, die der Graf aber nie antreten wird. Wahrscheinlich war die Story vom königlichen Versprechen auch fingiert. Agnes beruhigte die Gemüter, indem sie ihn auf den zweiten Platz verwies. Berthold von Zähringen sollte dann eben der nächste Herzog von Schwaben werden. Ungeklärt ist auch die folgende Geschichte: Agnes soll Rudolf von Rheinfelden nicht freiwillig in das Amt gehoben haben. Rudolf soll die minderjährige Tochter der Kaiserin, Mathilde, aus dem Kloster entführt und dafür die Herzogswürde von Schwaben gefordert haben. Er ehelichte das Kind 1057, wenige Jahre nach der Verlobung. Sie starb mit 12 Jahren im Jahr 1060. Der Vorgang der Entführung wird heute angezweifelt, findet sich aber noch in einigen Quellen. Es wurde Mathilde sogar nachgesagt, sie hätte ein Kind geboren.
Der neue König wurde Heinrich IV, welcher später seinen berühmten Gang nach Canossa antrat. Dieser Streit zwischen Papst und Kaiser hat auch das Herzogtum Schwaben getroffen und trug zu seinem Untergang bei.
Rudolf von Schwaben sah sich immer mehr als König von Deutschland. Der Herzog Otto von Northeim aus Bayern führte einige Komplotte und Gefechte gegen den König aus und unterstützte Rudolf von Schwaben. Dem Welfen wird nachgesagt, er habe mit Rudolf gespielt und ihn ausgenutzt. Auch der Graf aus Altdorf (Weingarten) unterstützte ihn. Im Jahr 1073 plante Rudolf bereits, sich zum Gegenkönig wählen zu lassen und versagte dem König den Beistand im Kampf gegen die Sachsen. Doch es kam zur Versöhnung. Vier Jahre später zog er es durch und stand als Gegenkönig im Raum. Denn Heinrich IV stand im Büßerhemd vor der Burg Canossa und bat den Papst um Verzeihung und die Rücknahme der Exkommunikation, weshalb ihm etliche Fürsten die Gefolgschaft versagten. Er schwächte mit der Buße vor dem Papst seine Position, konnte aber vorerst Kaiser bleiben.
Ein Vasall von Rudolf, Regengar, erklärte dann, dass der König ihn aufforderte, die Herzöge zu meucheln. Dahinter steckte aber ein Plan der Sachsen, um den Ruf des Königs zu schädigen und ihn dadurch zu schwächen. Rudolf agierte wenig impulsiv und ließ den Fall untersuchen. Der sächsische Clou ging auf – der König schwächelte, was sich sogar in seiner Gesundheit spiegelte. Aber die Wormser Bürger standen zum König und vertrieben den Bischof, der dem König den Zugang verwehrte. Sie unterstützten den König in seinem Vorhaben, den Geistlichen mehr Disziplin zu verordnen. Derartiges befürchtete man auch in Mainz, weshalb sich Rudolf nicht traute, die Krönung als Gegenkönig durchzuführen.
Als Gegenkönig verlor Rudolf von Rheinfelden im Mai 1077 das Amt des Herzogs von Schwaben und fand in Sachsen eine vorläufige Heimat. Dort kursierte das Gerücht, der König wolle den sächsischen Adel ausrotten und den schwäbischen Adel einsetzen. Finde den Nutznießer und erkenne den Verantwortlichen. Selbstverständlich kam es zu militärischen Auseinandersetzungen und selbst der Papst erklärte Rudolf zum deutschen König. Dafür ließ Heinrich IV den Papst absetzen.
Doch Rudolfs Macht schwand. Denn die Fürsten versagten ihm die Gefolgschaft. Nur Sachsen hielt zu ihm. Die militärischen Auseinandersetzungen um die Königskrone wurden vor allem in Schwaben geführt. Selbstverständlich litt darunter zuvorderst die einfache Bevölkerung.
1080 bekriegten sich Rudolf und Heinrich IV in der Schlacht bei Hohenölsen, jedoch ohne ein Ergebnis. Allerdings erlag Rudolf den Verletzungen der Schlacht. Der Legende nach soll ein unbenannter Ritter aus Heinrichs Heer den Gegenkönig erstochen und ihm die Schwurhand abgetrennt haben.
Aufstieg der Staufer oder der Zähringer? Die Teilung Schwabens
Schon ein Jahr vor dem Tod von Rudolf von Schwaben ernannte der König einen neuen Herzog: Grafen Friedrich von Staufen. Er war mit den Zähringern verbandelt und konnte daher eine Legitimation vorweisen. Er nannte sich zum ersten Mal von Staufen und begründete damit die Staufer-Dynastie. Er war mit Agnes von Waiblingen verheiratet, die mit dem König verwandt war. Die Inthronisierung erfolgte aber nicht in Schwaben, denn dort war der König nicht so beliebt. In Schwaben griffen die Grafen immer mehr nach der Macht. Allen voran die Welfen, aber auch die Zähringer. Der Sohn Rudolfs aber hatte sich bereits zum Herzog wählen lassen, wogegen weder Friedrich von Staufen noch der König etwas tun konnten. Die Opposition in Schwaben war bereits in der nächsten Generation angekommen. Es begann die Epoche der Zähringer Herzöge von Schwaben. Überall konsolidierte man die Güter und tauschte sie oder erwarb das Nachbargrundstück, um die Grundherrschaft miteinander zu verbinden.
Neben einem Gegenpapst, einem Gegenkönig und gelegentlichen Gegenabten und -Bischöfen, gab es nun auch einen Gegenherzog von Schwaben. Diese Reihung von Gegenherzögen zieht sich durch das gesamte 13. Jahrhundert. Nur auf königlicher Seite gab es kurzzeitig keinen Herzog, sodass das Amt an den König fiel.
Das alles entstand unter dem Eindruck des Investiturstreits und der Frage, wie diszipliniert die Kirche eigentlich sein sollte. Der Investiturstreit ist vordergründig die Frage, ob der Papst oder der König Kirchenleute einstellt. Aber es ist vielmehr eine Machtfrage zwischen den weltlichen Herrschern und den geistlichen Führern. Und dieser Streit erreichte nun auch die Ebene der Herzöge. Sollten die Geistlichen in Armut und ehelos leben? Sollte dem König die Kirche unterstehen? Diese Fragen spalteten Europa, Deutschland und Schwaben.
Das Herzogtum Schwaben wurde bald zwischen den Welfen in Oberschwaben und den Zähringern von der heutigen Nordschweiz bis zum Neckar geteilt. Im Jahr 1098 einigten sich Friedrich und der Gegenherzog Berthold I darauf, dass sie beide die Herzöge wären. 1218 starb der letzte Auch-Herzog aus dem Geschlecht der Zähringer.
Die Staufer trugen vielleicht aus Gewohnheit den Titel der Herzöge von Schwaben, aber dort hatten sie keinen Einfluss. Offiziell aber konnten sich die Staufer außerhalb Schwabens durchsetzen. Sie begründeten die Dynastie der Stauferkönige, zu denen auch Barbarossa (Friedrich II von Staufen) zählte.
Nach 200 Jahren endete die Dynastie der Staufer. Der letzte Vertreter des Hauses, Konradin, wurde 1268 gefangen genommen und auf dem Marktplatz von Neapel von seinen Feinden enthauptet.
Friedrich II vs Heinrich VII
Auch in dieser Epoche gab es einen Vater-Sohn-Zwist, der sich um das Herzogtum Schwaben drehte. Der Vater, Friedrich II. (aber nicht Barbarossa), übergab das Herzogtum seinem Sohn Heinrich VII. Noch immer quälte die Frage, ob Kirche oder König das Land.
Heinrich VII heiratete eine Frau, die sein Vater ausgesucht hatte. Bald schon wollte er die Scheidung, aber das wurde ihm ausgeredet. Dem nicht genug. Als Bayern von der kaiserlichen Seite absprang, griff Heinrich VII ein. Er erweiterte seine Machtbefugnisse auf Kosten der Städte, was sich gegen die Fürsten richtete. Daher wendeten die sich an den Vater und zwangen ihn, sie davon zu befreien. Es war nicht das einzige Mal, dass der Vater des Sohnes Verordnungen aufhob. Derart bevormundet wehrte sich Heinrich. Die Gräben vertieften sich, als der Papst, Gregor IX, Heinrich VII bannen würde, sollte er seinem Vater nicht gehorchen. Heinrich VII holte sich antikaiserliche Verstärkung und, es war eine Frage der Zeit, verstieß er gegen des Vaters Anweisungen. Und einen Skandal weiter war es dann so weit. Der Papst exkommunizierte Heinrich VII, was dieser zum Anlass nahm und Truppen zusammenzog. Er fand Verbündete als auch einen Widerstand bei Königstreuen, was ihn militärisch band. Im Juni 1235 standen sich die beiden Heere im Swiggertal gegenüber. Des Kaisers Truppen waren dem Lager des Sohnes weit überlegen. Im Juli unterlag er erneut und wurde auf dem Reichstag des Monats in Worms entmachtet. Erst im Gefängnis, dann verbannt nach Apulien, wo er abermals in verschiedenen Gefängnissen einsaß. Ob willentlich oder nicht, er stürzte im Jahr 1242 in einen Abgrund. Offenbar war er an Lepra erkrankt, was es ihm unmöglich machte, an die Macht zurückzukommen.
Der Fluch traf auch die letzten Herzöge | Aufstieg der Habsburger?
Die aufstrebenden Grafen von Habsburg durften auch mal. Sie würden später als Österreicher für lange Zeit den Kaiser stellen. Rudolf I von Habsburg kam als erster auf die Idee und erklärte als Thronfolger seinen Sohn Rudolf II zum Herzog von Schwaben. Man wollte sich mit dem Titel etwas schwäbischen Glanz verleihen, aber der Fluch schlug wieder zu.
Obwohl militärisch siegreich, verstarb Rudolf II im jungen Alter von 20 Jahren in Prag. Der Grund ist nicht überliefert. Noch mehr traf seinen Sohn Johann der Fluch, denn mit ihm endeten die Linie und das Herzogtum Schwaben.
Als er sechs Jahre alt war, verstarb seine Mutter. Sein Onkel, König Albrecht I, bedrängte ihn und verlangte das Erbe seines Vaters. Und als Vormund wollte er die Güter der Mutter übertragen sehen. Die Begründung war ein Edikt des Vaters, in der die Nachfolge geregelt war. Es ging also um eine eigenwillige Interpretation des Ausgleichs für den Verzicht an einem Teil der Macht. Da Johann den Schaden hatte, folgte der Spott als „Herzog ohne Land“ auf den Fuß. Schließlich gründete er eine Verschwörung gegen König Albrecht I.
Am 30. April 1308 lud Albrecht zum Festmahl. Auch Johann nahm daran teil. Albrecht ließ Blumenkränze verteilen, welches Johann ihm ins Gesicht warf. Der Eklat war komplett und die Party vorüber.
Am nächsten Tag begab sich Albert I auf den Heimweg. Doch er hat sein Ziel nie erreicht. Die schwäbischen Mitverschwörer Johanns, die Ritter Rudolf von Balm, Rudolf von Wart, Konrad von Tegernfelden und Walter von Eschenbach lauerten Albert I bei Windisch auf. Sie hielten ihn an und als es so weit war, ritt Johann auf ihn zu. Mit dem Willen zur Macht zog er sein Schwert und schlug es mit aller Gewalt auf des Königs Kopf. Es war ein Königsmord, ein Mord an einem Verwandten. Daher trug er fortan den Namen Johann Parricida, was sinngemäß der Verwandtenmörder ist.
Die Rache um das geprellte Erbe war ihm zwar sicher, aber der Mord an seinem Onkel blieb nicht ungesühnt. Der König war tot, aber der nächste Lehnsherr entmachtete und ächtete die Verschwörer. Johann betrat den Büßerweg und wurde wieder rehabilitiert, allerdings im Kloster in Pisa. Johann wurde 23 Jahre alt, hinterließ keinen Erben und war der letzte Herzog von Schwaben. Johanns Geschichte findet sich auch in Schillers „Wilhelm Tell“ wieder.
Allerdings wäre sein Herzogtum nur noch ein Flickenteppich gewesen. Denn zwischenzeitlich hatten sich die Württemberger hervorgetan. Das Herzogtum bestand noch aus Nieder- und Oberschwaben. 1378 blieb nur noch Oberschwaben und schließlich erhielt Österreich den Zuschlag, die ja dem Haus Habsburg entstanden.
Erst 1806 gab es wieder einen Adeligen von Schwaben. Der Württemberger Friedrich Wilhelm Karl bezeichnete sich im Beititel als „Fürst von Schwaben“. Nach der Reichsauflösung nannte er sich auch wieder Herzog von Schwaben (und von Teck), allerdings gab es das Herzogtum Schwaben nicht mehr. Er brachte die Löwen ins Wappen und wurde der erste König von Württemberg – von Napoleons Gnaden.